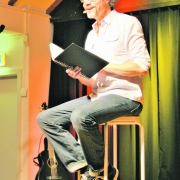Der Meister des Lakonischen
Rüdiger Hoffmann galt in den 90er Jahren als einer der angesagtesten deutschen Kabarettisten.
Sein minimalistischer Stil, der viele an langweiligen Fußball erinnerte und dabei doch so bärbeißig-komisch war, führten den gebürtigen Paderborner in Shows wie „Samstag Nacht“, als einzigen Komiker ins Vorprogramm der Rolling Stones und brachte ihm die „Goldene Europa“ im Bereich Comedy ein. Gut 20 Jahre später steht er immer noch auf der Bühne, und das Publikum mag ihn noch immer.
Im Kevelaer Bühnenhaus forderte der vollbesetzte Saal nach seiner letzten Nummer im Programm vehement eine Zugabe und zeigte sich begeistert von einem Künstler, der irgendwie der Gleiche geblieben ist – eben nur auf Höhe der Zeit. Und Hoffmann dankte es mit dem Dank an ein „super Publikum – das sage ich nicht immer.“
Hallo erstmal
Natürlich arbeitet Hoffmann noch immer mit seinem speziellen Elementen – gleich zur Begrüßung mit „Ja, hallo erstmal…“ oder dem Klassiker „Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten“, die beide heutzutage zum geflügelten Wortschatz gehören.
Und elegant ist es schon, zum Einstieg ein Gespräch mit einem Bekannten einzuflechten, dessen Traum es schon immer gewesen sei, nach Kevelaer zu kommen. Dieser sei „letztens in Australien bei Bekannten gewesen, die sagten: Wenn sie mal nach Europa kommen: Paris, London, Kevelaer.“
Dazu kommt dann noch die wissenschaftlich bewiesene Erkenntnis: „Lachen ist gesund“ – vor allem fürs Immunsystem. „Wer Allergie hat, das müsste so gegen 22 Uhr 15 weg sein“, sagte Hoffmann. Und es sei dabei nicht entscheidend, worüber man lacht: „Diese Erkenntnis hat die Karriere vieler meiner Kollegen erst möglich gemacht“, machte er selbstbewusst – oder vielleicht selbstironisch ? – klar.
Und so nahm er sich heraus, das visionäre Element von Häschenwitzen herauszustellen oder die inspirierende Wirkung von selbst gestalteten Witz-Trauerreden bei Beerdigungen.
Hoffmann erzählte über den Urlaub mit Hans-Peter und Monika mit „laktosefreien Getreidecrackern“ am holländischen Campingplatz „ganz genau wie früher“ – wo das Hundeklo für Hund und Mensch daneben stand und das Fussballtor dahinter ohne Netz.
Hoffmann machte den Unterschied von früher und heute klar. Früher, „da gab´s noch Festnetz – was das ist, müsst ihr mal googeln“ und „da musste man sich richtig unterhalten – mit dem Mund“ und es gab einen Wortschatz, „der mehr umfasste als ,Gefällt mir‘ oder ,Gefällt mir nicht‘.“
Er philosophierte über Selbstoptimierung als „Religion des heutigen Lebens“: 80 Prozent der Deutschen sind mit dem Leben zufrieden, der Rest sind FC-Köln-Fans.“ Zumal selbst die Atomkraft ab 2022 kein Problem mehr sei – „wenn nicht grade in Belgien oder Frankreich so ein Ding hochgeht“ und der Atommüll erst nach drei Milliarden Jahren neutralisiert ist.“
Und er ironisierte am Klavier mit Gassenhauern wie „Die haben das Eimersaufen auf Mallorca verboten – was sind das denn nur für Vollidioten ?“ oder klavierrappend als „MC Obervollpfosten“ über den Sonderparkplatz für den SUV und den Wegfall der Kapitalertragssteuer.
Heavy Metal und Frühjahrsmüdigkeit
Nach der Pause steigerten sich Qualität und Gagdichte des Programms. Er sprach über die Freundin, die sich über Studien in Heften wie „Brigitte“ oder Bella“ informiert – wie „Männer haben voll einen an der Waffel von Geburt an“, „100 Prozent der Menschen in einer Ehe sterben“ oder Heavy-Metal als Entspannungsmusik – hinter Bach: „Da haben wir die ganze Woche die Kristina Bach gehört“ und der Arzt habe bei der Freundin dann eine Schlagerallergie festgestellt.
Hoffmann sprach über seine untauglichen Bemühungen gegen Frühjahrsmüdigkeit. „Nach dem ersten Liegestütz bin ich liegengeblieben, nach der zweiten Gabel Salat umgekippt und mit Gurkenmaske aufgewacht. Oder beim „Schweigen der Lämmer“: da „gab´s Augenlicht aus und bubu.“ Selbst der 200-Watt-Scheinwerfer auf´s Sofa und die zusätzlichen Lampen im Garten und in der Garage zogen nur „den Pilot der Billigairline“ an.
Drei Nummern stachen dann heraus: die bitterböse Nummer als vorurteilsvoller Spießbürger, der bei einem „ausländischen Mitbürger“ namens Herrn Meier vor drei Generationen einen „Achtelfranzosen“ ausmachte. „Dem merkt man es aber nicht an – überhaupt nicht, gar nicht, aber so ein bisschen schon“, machte er sich Gedanken darüber, was wäre „wenn man einen Schwarzen noch mit dabei hätte, dann könnte er sich nicht so einfach verstecken.“ Und den man als „unkalkuliertabes Risiko“ aus der Nachbarschaft entfernt habe – bis Hoffmann die Rolle auflöste und sagte: „Das ist eine offene Anstalt, wo ich untergebracht bin.“
Faszinierend geriet auch seine Puppennummer mit dem „Kleinen Vacek“ am rechten Arm, bitterböse seine Schützenbruder-Geschichte und aus der „Selbsthilfegruppe anonymer Ausländerfeinde“ – und optimistisch-ohrwurmig sein Abschlusslied „Hoch hinaus“.