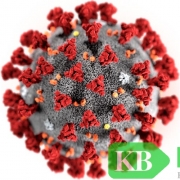Dass das Coronavirus auf sämtliche Bereiche der kirchlichen Arbeit Auswirkungen hat, das durfte die evangelische Pastorin Karin Dembek in den letzten Wochen sehr hautnah erleben. Aber aus ihrer Sicht waren „Beerdigungen von Anfang an das, das ich gefühlsmäßig am schlimmsten fand.“
Denn die Einschränkungen betreffen den gesamten Ablauf des Abschieds von einem Menschen – in Form, Anzahl, Charakter und der Art, wie man damit neu umgehen muss. „Ich finde es am greifbarsten, wie schrecklich die Maßnahmen sind – für die Trauernden und für mich.“
Dieses Gefühl kam für sie von Anfang an auf. „Ich hatte eine Trauerfeier ganz am Anfang der Corona-Krise, die schon unter die Auflage fiel, dass bei der Beerdigung nur 20 Leute dabei sein durften.“ Da ging es um ein sehr aktives Chormitglied der Gemeinde, das sie seit 20 Jahren kennt und dessen Frau zwei Jahre zuvor gestorben war. „Das war eine große Familie.
Und die wünschte sich eine Trauerfeier, wie sie für die Mutter gewesen war – mit Chor und dass viele teilnehmen können.“ Als dann klar wurde, dass auch keine Gottesdienste mehr in der Kirche möglich waren, musste Dembek der Familie sagen, dass es nur der ganz enge Familienkreis sein wird, der zusammenkommt, und nur Musik vom Band möglich ist. „Das war für die ganz schwer zu verstehen – rational schon, aber vom Gefühl her war das schwer.“
Da habe sie selbst gemerkt, „dass die Menschen bei der Beerdigung diese Nähe brauchen, dieses Zusammenstehen oder dass man sich umarmt.“ Das alles war in der Form nicht möglich. Und dann standen alle Anwesenden um das Grab in einem großen Abstand. „Das ist dann wirkliche Distanz und eine traurige Geschichte“, findet sie.
Den würdevollen Charakter beibehalten
Die Trauerfeiern fanden vor der Trauerhalle statt, weil die Stadt diese auch geschlossen hatte. „Wir haben hier eine gemacht, wo nicht klar war, ob man in die Kirche darf. Da hatte die Stadt die Trauerhallen geschlossen und wir haben gesagt, da können wir dann nicht in die Kirche gehen.“ Da fand dann alternativ die Trauerfeier in dem benachbarten Garten statt. „Das war zwar schön gestaltet, aber es war trotzdem merkwürdig.“ Die Bestatter gäben sich alle Mühe, alles schön hinzustellen, platzierten auch Stühle in weitem Abstand.

Pfarrerin Karin Dembek.
Sie selbst gestalte die Trauerfeiern auch kürzer. „Beim ersten Mal war es ein extrem kalter Wind und ich dachte: Wie lange kann man das aushalten, da so zu stehen und dann auch am Grab mit Abstand?“ In der Regel fehle auch die Musik. „Das hat was nicht ganz Richtiges“, findet Dembek. „Es ist schwer, da den würdevollen Charakter beizubehalten.“
Denn jeder Mensch habe den Anspruch auf eine würdige Beisetzung. Auch dass die Gemeinde vielleicht im Nachhinein von einem geliebten Menschen Abschied nehmen kann, gehe nicht. „Ich dachte, das kann man später beim Sterbegedenken nachholen. Da dachte ich nicht daran, dass die Kirchen länger geschlossen bleiben würden.“
Der Gedanke, eine große Trauerfeier und einen Erinnerungsgottesdienst für alle Verstorbenen zu machen, mache aktuell auch wenig Sinn, weil halt nicht so viele Menschen in die Kirchen dürfen. „Das war die Denke vor Corona.“ Und Trauerphasen künstlich verlängern, sei nicht sinnvoll. „Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Da bin ich von der Corona-Krise überholt worden.“
Die Trauergespräche am Telefon führen
Aktuell sind Trauergottesdienste in der Kirche mit 30 Personen, Beerdigungen am Friedhof mit 20 Personen erlaubt, „sodass man im Trauergespräch erläutern muss, wie es auf dem Friedhof ist, dass die Bestatter immer die genaue Zahl haben.“ Auch der Charakter der Trauergespräche habe sich geändert. „Eigentlich sind wir vom Kirchenkreis gehalten, möglichst telefonisch Trauergespräche zu führen, weil es Kollegen gibt oder Partner von ihnen, die der Risikogruppe angehören.“ Selbst habe sie persönliche Trauergespräche geführt – allerdings nur mit einem Angehörigen und mit entsprechendem Abstand. „Das war auch für die Angehörigen zum Teil nicht so einfach.
Aber ich kann dann nicht mit fünf, sechs Leuten Trauergespräche führen lassen. Das sind unterschiedliche Familien, die nicht zusammenkommen dürfen.“ Und bei großen Familien merke man schon die Unsicherheit der Person, die da ist. Es hätte auch die theoretische Möglichkeit einer Videokonferenz gegeben. „Aber das würden wir beim Trauergespräch gar nicht hinkriegen.“ Und auch das Kaffeetrinken, das einen „hohen Sozialfaktor, einen entlastenden Faktor hat, weil der eine Anekdötchen vom Angehörigen erzählt, man sich austauscht, alte Verbindungen neu entstehen“, das fiel komplett weg. „Die gehen dann am Grab weg, stehen danach zwar noch in Gruppen, aber dann geht jeder zu sich. Da fehlt was.“
Johannes Kamps arbeitet seit über 35 Jahren als Bestatter. Eine Zeit wie im Moment, die hat auch der 65-Jährige, der mit seinem Institut an der Bahnstraße sitzt, in der Form so noch nicht erlebt. „Wir sind ja räumlich eingeschränkt. Wir können nicht mehr in die Friedhofskapelle wegen des Versammlungsverbots. Eine begrenzte Zahl ist schwierig. Und die Leute können sich nicht in den Arm nehmen“, sieht er die vielen kleinen Dinge, die zusammen schon eine Belastung für alle Beteiligten darstellen. Und wenn dann noch der Aspekt einer Corona-Infektion dazukommt, ist die Möglichkeit, sich persönlich von einem sterbenden Angehörigen zu verabschieden und dann Trauerbewältigung zu begehen, noch schwieriger.
Kamps und seine sechs Mitarbeiter haben in der vergangenen Zeit bereits mehrere Corona-Fälle erlebt. „Da können die Angehörigen gar nicht mehr zu den Verstorbenen rein wegen der Ansteckungsgefahr.“ Selbst müsse man sehr ausführliche Schutzmaßnahmen ergreifen, um den oder die Verstorbene dann abzuholen. „Wenn eine verstorbene Person eine ansteckende Krankheit hat, erhalten wir die Information und stellen uns direkt um.“ Mit Gelbsucht hatte man schon zu tun. „Corona ist ganz anders, weil der Virus aggressiver ist. Solche Sicherheitsauflagen hatten wir noch nie.“

Pastor Manfred Babel.
Die Mitarbeiter tragen dann Masken, Schutzkittel und Handschuhe, macht Kamps deutlich, wie gewissenhaft man in so einer konkreten Situation handeln muss. Sterben sie im Krankenhaus, bringt man die Verstorbenen zunächst in eine Prosektur – einen separaten Raum. „Sie kommen dort in eine desinfizierte Folie.“
Danach werden sie mit einer Trage, die regelmäßig desinfiziert werden muss, in den Sarg gehoben und der Leichnam dann in den Beerdigungswagen gebracht. Bei der Beerdigung selbst ist Kamps mit anwesend, dazu seine Träger und die beschränkte Anzahl an Personen mit Priestern und Angehörigen. „Das ist alles sehr befremdlich, wenn sich Geschwister nicht in den Arm nehmen können, um um den Vater oder den Großvater zu trauern.“
Die Distanz mache sich bemerkbar. „Das ist sehr sachlich und kühl“, ist seine Beobachtung. In den Vorgesprächen müsse man die Einschränkungen erklären. „Wir wissen nie, wie das mit dem Versammlungsverbot konkret aussieht. Das wird alle 14 Tage entschieden.“ Dann komme es auch mal zu Veränderungen – so wie jetzt zum Beispiel, dass man unter Umständen nach der Beerdigung Kaffee zusammen trinken kann, wenn auch auf 1,50 Meter Abstand.
Im Zuge der Corona-Krise „mussten wir erstmal eine Form“ finden, wie so eine Beerdigung ablaufen kann – zum Beispiel „mit kurzer Andacht an der Friedhofskapelle.“ Auch das zu gestalten, ist nicht unproblematisch, „wenn es regnet und dann steht man draußen.“ Bislang hat das Wetter aber mitgespielt. „Wir stellen draußen ein paar Stühle hin – und die stellen wir dann 1,50 Meter bis zwei Meter weit auseinander.“
Angesichts der Personenanzahl werde oft schon im Vorfeld selektiert, dann die Information über die Beerdigung weitergegeben. Es gebe auch Familien, die zum späteren Zeitpunkt eine Gedenkfeier abhalten wollen, wo sich dann alle Trauernden versammeln können.
Auch Andreas Poorten bemerkt Schwierigkeiten
Andreas Poorten ist froh, dass sich unter den Personen, die er beerdigt hat, keine Corona-Fälle befanden. Auch der Pastor der St. Antonius-Kirche hat die Erfahrung gemacht, dass sich der Charakter der Trauerfeierlichkeiten insgesamt deutlich durch Corona verändert hat. Die Begrenzung auf die Trauergruppe, die sei schwierig, bestätigt er die Eindrücke seiner evangelischen Kollegin. „Ich hatte jemanden, der die ganze Zeit im Krankenhaus lag und überraschend starb.
Der konnte keinen Besuch von den Angehörigen haben. Und wenn der erweiterte Kreis dann nicht mit beerdigen kann, ist das schon eine schwierige Belastung.“ Denn mit Kindern, Partnern, vielleicht Enkeln sei die Grenze schnell erreicht, so Poorten. Und das Thema Risikogruppe spiele bei der bewussten Auswahl der Personen auch eine Rolle. Das überlegten die Angehörigen sehr genau.
Bei der Feier fehle die Trauerhalle als Ort, „weil man von einem Raum umgeben ist“ und sie so für die Trauer den nötigen Raum und den Schutz geboten hat. „Auf einem freien Platz ist das nicht der Fall.“ Und auch das Feierliche dort gehe verloren. „Da wird auch schon mal gesungen. Aber das liegt an der Familie selbst. Oft hat es ihnen die Sprache verschlagen.“
Zum Glück sei es die ganzen Wochen über zu den Beerdigungen immer trocken geblieben, sodass die Gottesdienste vor der Feierhalle stattfinden konnten. Natürlich werde auf den Abstand geachtet, Stühle entsprechend hingestellt. Dass die engsten Angehörigen wie Witwe, Sohn und Tochter dann aber am Grab nebeneinander beim Abschied stehen, findet Poorten in Ordnung.
„Das fände ich sonst furchtbar.“ Auch ihm fällt auf, dass sich die Trauergemeinde schnell auflöst und mit dem gemeinsamen Kaffee eine wichtige soziale Funktion wegfalle. „Das steigert die Isolation, dass sich Menschen nicht anderen zuwenden können.“
Und das gerade in so einer persönlichen Situation. Mittlerweile könne man nach den neuen Regeln auch wieder Trauergottesdienste machen – aber auch da muss man im Vorfeld schon mit den Angehörigen Regelungen schaffen. „Uns war wichtig, dass die Trauergemeinde auf dem Friedhof anders konstruiert ist, weniger dort sind als in der Kirche. In der Kirche können durchaus mehr teilnehmen“, sagt Poorten.
„Aber wir wollen da die Angehörigen bitten, das nicht in die Zeitung zu setzen. Denn solange wir nur so kontrolliert die Leute hineinlassen können in die Kirche – und stellen Sie sich vor, wir müssten jemanden bitten, aus der Kirche herauszugehen – bitten wir um eine gewisse Verschwiegenheit.
Seit Ostern hat der Winnekendonker Pastor Manfred Babel „vier oder fünf Beerdigungen“ erlebt. „Die Leute sind sehr diszipliniert mit der Botschaft umgegangen, dass wir in relativ kleinem Kreis beerdigen konnten. Das sei oft „sehr würdig verlaufen.“ Unter den Beeerdigten befand sich auch eine Person, die durch das Corona virus gestorben war. „Die Angehörigen waren sehr, sehr traurig. Es waren nur vier Leute da und es musste eine Urne sein.“
Die Feier habe verkürzt stattgefunden. „Man liest das oft in der Zeitung, dass es Menschen betrifft, die nicht mehr so jung sind. Aber wenn es der eigene Vater für die Angehörigen ist – und der erste Mensch, den man als Pastor selbst beerdigt, dann ist man anders berührt.“