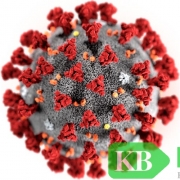Tränen, Sehnsucht und Abstand
Mit 32 Jahren Berufserfahrung zählt Ellen Ricken zu den erfahreneren Kräften im St. Elisabeth-Stift. Die 52-jährige examinierte Altenpflegerin arbeitet seit 18 Jahren beim Deutschen Orden. So eine Situation wie aktuell, die hat sie so noch nicht so erlebt. „Das ist alles sehr bedrückend“, sagt sie auch in Bezug auf das Besuchsverbot, das im Haus seit dem 13. März gilt. Das fängt dann schon bei Alltäglichkeiten an, die für ältere Menschen im Heim oft eine wichtige Bedeutung haben. „Es gibt keine Fußpflege, keinen Friseur“, erzählt Ricken. „Wir mussten den Leuten teilweise schon die Haare selbst schneiden. Das ist natürlich schwierig.“
„Du hast nicht mehr diese Masse, dass die abends zusammensitzen. Die müssen dann ins Zimmer, Musik hören oder Fernsehen, weil Menschenansammlungen nicht sein dürfen.“ Die mobilen Personen dürften auch mal begleitet vor die Tür oder auch mal spazieren gehen. „Aber dabei darfst du keinem über den Weg laufen.“ Und die Angehörigen dürfen ihre Lieben im Heim nicht sehen, „außer du hast Leute, die in der Sterbephase sind. Da wird nach Absprache entschieden, dass die sie nochmal besuchen können oder nicht.“ Da gelten natürlich auch verschärfte Bedingungen. „Mit Schutz und Handschuhen dürfen sie sich verabschieden, das ist für alle sehr kräftezehrend. Und die Psyche, die leidet.“ In der Pflege selbst werde auch nochmal verschärft auf Hygienemaßnahmen geachtet.
Immer wieder komme es zu Situationen, in denen Bewohner am Tisch sitzen und weinen. Das berühre sie sehr. „Da kann man sie nur so gut wie möglich trösten, dass es besser wird.“ Aber es gibt auch Bewohner, die mache das teilweise wütend, erzählt Ricken. „Eine Bewohnerin sagte am Montag: Was habe ich mit Corona zu tun?“ Und es sei eine Unsicherheit zu spüren unter denen, die das Ganze gedanklich noch verstehen können. Den Kontakt halten viele Angehörige über das Telefon. „Die rufen an, damit sie wenigstens solange reden können, wie sie wollen. Das hilft wenigstens ein bisschen.“ Wie lange man so einen Zustand insgesamt aushalten kann? „Keine Ahnung“, antwortet Ricken.
Situation bringt viele Neuerungen
„Wir sind im Moment noch nicht betroffen, dass wir einen positiven Bewohner haben. Bis jetzt ist der Kelch noch an uns vorübergegangen“, schwingt bei Pflegedienstleiter Patrick Znak Erleichterung mit. Aber auch beim Personal „gibt es Mitarbeiter, die selbst vorerkrankt sind und Ängste haben.“ Schon jetzt gebe es da „den einen oder anderen Verlust zu beklagen, weil Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen können, weil da die Psyche nicht mitmacht.“ Darunter seien Menschen, die Asthmatiker sind oder COPD haben. „Die haben einfach Angst, das Haus zu verlassen.“ Somit kämpfe man aktuell vor allem „an drei Fronten: die Bewohner, die Mitarbeiter und die ganzen Gesundheitssachen, die neu kommen.“
Corona, das sei das eine. Aber das Besuchsverbot und nicht raus zu können, da befürchtet Znak, „dass sie in ein anderes Problem reinschlittern“ wie Depressionen, gerade auch bei entsprechenden Vorerkrankungen. „Das merkt man bei ein, zwei Bewohnern. Die weinen Rotz und Wasser. Die fragen sich, wo die Angehörigen bleiben. Die können das emotional-gedanklich nicht umsetzen.“ Es gebe die Besuchs-Ausnahme bei denjenigen, „die präfinal und im Sterben liegen“, sagt Znak. „Aber mit Mundschutz, Handschuhen und Schutzkittel, da fehlt die Nähe, man kann sich nicht trösten. Das ist nicht so, wie man sich die letzten Tage so vorstellt“, ist er sich mit seiner Kollegin Ellen Ricken einig.
Und auch sonst führt der Zustand zu abstrakten Situationen. „Wir haben eine Lebensgefährtin, die kommt an die Straße, er ans Fenster und die unterhalten sich auf Luftlinie. Wir haben zwei Personen, wo wir den Kontakt über Videoanruf oder einmal über Skype gemacht haben. Ansonsten telefonieren die am meisten.“ Über einen Skyperaum habe man bisher noch nicht nachgedacht. Zwei, drei Bewohner gingen in Begleitung schon noch nach draußen und in die Stadt. „Wir haben denen abgeraten, die mobil und geistig auf der Höhe sind. Aber festbinden kannst du sie auch nicht.“ Das Personal sei da „mehr gefordert denn je, weil die auf die Bewohner eingehen und emotional abholen müssen.“ Bei 21 zu versorgenden Bewohnern auf einer Station sei das jedoch oft nicht so einfach umzusetzen. „Die Kohle holt da der soziale Dienst aus dem Feuer, weil die die meisten Berührungspunkte zu den Menschen haben. Aber das ist schon nicht ohne.“
Die Corona-Situation macht Einrichtungsleiterin Silvia Albat durchaus unruhig. „Das empfinde ich wie die Ruhe vor dem Sturm momentan.“ Die noch bestehende Situation, dass es bislang keinen Corona-Fall im Haus gibt, sei derzeit kein Ruhekissen. „So eine Anspannung, die ist da.“ Die Bewohner dürften schon vor die Tür, „aber sie dürfen nur Kontakt zu den Bewohnern und den Mitarbeitern, aber nicht zu Dritten haben. Und sie dürfen sich auch nicht außerhalb des Hauses mit Angehörigen verabreden.“ Mitarbeiter gingen mit den Bewohnern raus, auch der Soziale Dienst. „Die Bewohner sitzen mit denen in der Sonne und halten dabei Abstand.“
Eine Osterkarten-Aktion für die Bewohner
Um die Isolation etwas zu überwinden, habe das Haus jetzt passend zum Osterfest eine Osterkarten-Aktion gestartet. „Wir haben von jedem Bewohner ein Foto mit Osterhasen gemacht und schicken dieses Bild an die Angehörigen.“ Auf diese Art und Weise könne man zumindest eine gewisse Nähe zu ihren Lieben herstellen.
Wie lange man den Zustand jetzt aufrecht erhalten kann, darauf hat auch Albat keine Antwort. In den Gesprächen mit der Heimaufsicht habe sich aber eines klar gezeigt: „Alle sind sich einig, dass das Aufheben der Maßnahmen am 19. April zu früh wäre, weil hier die Risikogruppen sind. Das aufzuheben, ist nicht zielführend. Das Schlimmste wäre, wenn Corona ins Haus kommt und unkontrolliert rein und raus könnte.“