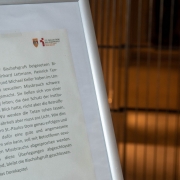Im Prozess gegen einen 50-jährigen Sozialpädagogen aus Kevelaer hat das Klever Landgericht heute sein Urteil gesprochen. Die siebte Strafkammer verurteilte den Angeklagten wegen schweren sexuellen Missbrauchs gegen Minderjährige in sechs Fällen und sexuellen Missbrauchs in 33 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann mehrfach zwischen 1998 und 2002 seinen Neffen sexuell missbraucht hat. Auch habe er sich in den von ihn organisierten Ferienfreizeiten acht Kindern im Schlaf genähert und sie sexuell berührt, ihre Hand genommen, um sich zu berühren und zu befriedigen. Die Übergriffe hätten 2013 auf Sylt und dann ab 2016 bis 2019 stattgefunden.
Außerdem muss der Angeklagte an zwei der Opfer, die durch eine Nebenklägerin vertreten waren, ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.000 Euro plus Zinsen zahlen. Die Nebenklägerin hatte vor Beginn der Plädoyers, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, den Antrag auf das Schmerzensgeld von „nicht unter 1.000 Euro“ mit Zinsen von 5 Prozent gestellt. Sie vertrat zwei geschädigte Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren mit ihren Familien. Der 13-Jährige sei „traumatisiert“, habe Magenschmerzen und Albträume und benötige eine „professionelle Aufarbeitung“ des Erlebten. Das „rücksichtslose Vorgehen“ des Sozialpädagogen würde eine solche Summe rechtfertigen, so die Anwältin.
Der Anwalt des Angeklagten hatte daraufhin ein Schreiben vorgetragen, in dem ein solches Angebot formuliert ist. Das Angebot bestehe für alle Opferfamilien als „ein Zeichen der Reue“ und könnte im Laufe des Jahres gezahlt werden, sobald der Angeklagte „seine finanziellen Dinge geregelt“ habe.
Tatumfang nach unten korrigiert
Das Gericht hatte vor den Plädoyers den Umfang der nachweislichen Taten nach unten korrigiert, insbesondere was die Taten im Zusammenhang mit dem Neffen betrifft. Ursprünglich war der Sozialpädagoge in 52 Fällen des Missbrauchs angeklagt worden. Dazu kam noch der Vorwurf des Besitzes von pornographischen Bildern, den das Landgericht aber fallen ließ. Man habe diese Bilder auf dem Cache des Computers gefunden. Es sei in der Rechtsprechung umstritten, ob der Fund in einem Cache für eine Verurteilung ausreicht, machte der Richter Christian Henckel deutlich.
In seiner Urteilsbegründung erklärte Henckel, dass der Angeklagte eine „massive pädophile Neigung“ habe, die womöglich auf das sexuelle Verhältnis zu seinem Cousin in der Kindheit zurückzuführen sei. Eine „Kernpädophilie“ liege aber nicht vor, da er auch zu Frauen sexuellen Kontakt gehabt habe. Dass er sich den Beruf als Veranstalter und Jugendleiter bewusst ausgesucht habe, um die Neigung auszuleben, „daran glaubt auch die Kammer nicht“, sagte Henckel. „Aber Sie waren sich im Klaren, dass sich die Gelegenheit durch die Leitung bot.“
Der Neigung nicht hilflos ausgesetzt
Das zeige die beständige Wiederholung der Taten. Spätestens nach dem ersten Übergriff „hätte Ihnen auffallen müssen, Konsequenzen zu ziehen – entweder therapeutisch oder Sie hätten mit den Fahrten aufhören müssen. Insgeheim wollten Sie das nicht, um nicht auf die Gelegenheiten zu verzichten“, so Henkel zum Angeklagten. Dieser sei seiner Neigung nicht hilflos ausgesetzt gewesen. „Sie hätten das steuern und verhindern können. Das wollten Sie offensichtlich nicht“, so der Richter, sonst hätte es nicht die Taten „über so einen langen Zeitraum zum Nachteil von Kindern“ gegeben.
Wie es sich damit für die Opfer weiterleben lasse, „lässt sich nicht im Strafprozess klären“, machte Henckel klar. Der Neffe stehe heute zwar im Leben, aber man sehe ihm an, „was für eine Betroffenheit und Belastung durch das Erlebte und Erduldete noch zu spüren“ gewesen sei, „für das Sie die Verantwortung tragen.“ Dazu komme die „Belastung des Verschweigens und Versteckens“ der Vorgänge. „Dass das eine Qual ist, ist deutlich geworden.“ Die vernommenen Kinder hätten ein unterschiedliches Bild aufgewiesen. Dabei sei es aber „nicht ausschlaggebend, ob Kinder das nur als verstörend empfanden oder als sexuellen Übergriff eingeordnet haben. Gravierend war es für alle gleichermaßen.“ Henckel drückte die Hoffnung aus, „dass sie das auf Dauer nicht beeinflusst. Ganz vergessen werden sie das nicht können.“
Auch Missbrauch von Vertrauen
Der Angeklagte habe seine Macht missbraucht, das Selbstvertrauen und den Selbstwert der Geschädigten beeinträchtigt, das Vertrauen missbraucht, das die Kinder ihm als „bewunderten Betreuer“ entgegengebracht haben „und das Vertrauen der Eltern, die Ihnen die Kinder in gutem Glauben überlassen hatten.“ Auch habe er das „Urvertrauen“ der Kinder geschädigt. In seiner eigenen Wahrnehmung habe er ihnen „ersparen“ wollen, die Übergriffe bewusst zu erleben. Darum sei er im Schlaf an sie herangegangen. „Im Endeffekt war es Ihnen aber egal“, sagte Henckel.
Eine Schuldminderung aufgrund seiner Depressionen oder aufgrund des Alkohols während der Freizeiten sah die Kammer nicht. „Sie haben die Situation geschaffen und gesteuert.“ Zugunsten des Angeklagten wertete Henckel dessen „Verhalten am Ende des Ermittlungsverfahrens“. Der Richter benannte das „unumwundene Geständnis“, das einigen Opfern die Aussage erspart habe, „und Ihre ehrliche Reue,“ die nicht nur als Show zu sehen sei.
Auch die Tatsache, dass die Taten bei dem Neffen länger zurückliegen, wertete das Gericht als straf-mildernd. Und es sei klar, dass „durch das Urteil Ihre berufliche und private Existenz vernichtet oder zumindest erschüttert ist, auch wenn Sie es zu verantworten haben.“ Dem gegenüber stehe „die Massivität, die Dauer der Taten und die Folgen für die Betroffenen.“ Das Gericht sah eine Wiederholungsgefahr als gegeben an.